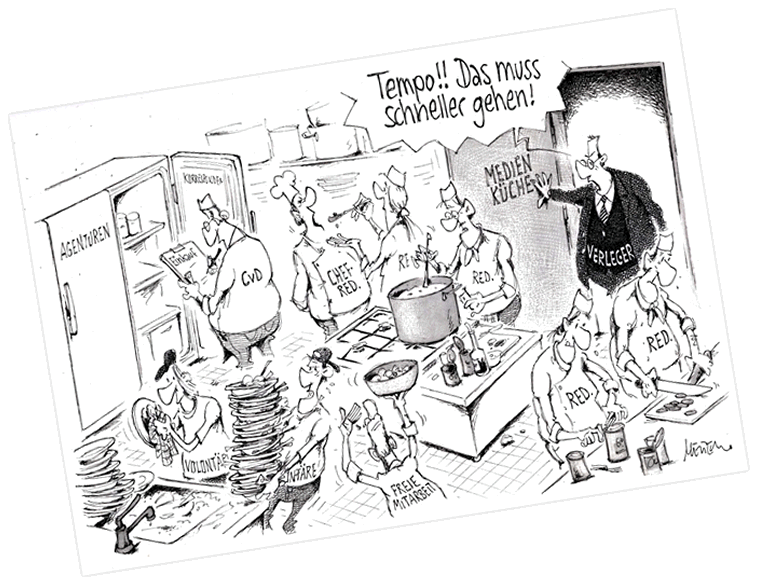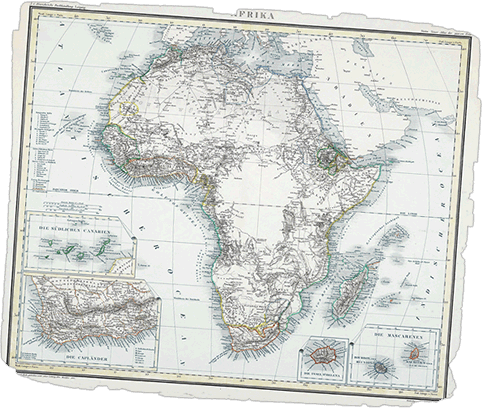Eingebetteter Journalismus
Das Reisen und Arbeiten mit deutschen Soldaten, wie etwa aktuell in Afghanistan, wird embedded journalism genannt. Für die Reporter – ob sie vom „Spiegel“, der ARD oder vom Deutschlandradio – ist diese Methode in erster Linie sicherer als ein Alleingang im Kriegsgebiet. Die Praxis kommt aus den USA, wo während des Golfkrieges ganze Scharen von Reportern mit den Streitkräften unterwegs waren. Dass hier allerdings eher einseitige Darstellungen von den Kriegsschauplätzen entstehen, liegt nicht nur daran, dass Reporter in den Soldaten meistens ihre einzigen Bezugspersonen haben und tagtäglich nur deren Sicht der Dinge erfahren, sondern auch daran, dass diese oft ihr einziger Garant für Sicherheit und unbehelligtes Arbeiten vor Ort sind. Unweigerlich werden Journalisten unter diesen Umständen zaghafter mit Kritik und der Darstellung negativer Seiten der Militäreinsätze.
Ein Redakteur und Medienberater in Afghanistan meint, es bestehe hier die Gefahr, dass Journalisten zu einem Rädchen in der militärischen Propaganda werden. Bei verharmlosenden Reportagetiteln wie „Leberkäs für Kabul“ wird deutlich, was er damit meint. Ein Grund für diese enge Anbindung an das Militär liegt in den Streben nach Kostensenkung. So erhielten Journalisten einwöchige Freiflüge nach Afghanistan, die die Bundeswehr organisierte und finanzierte.
Als „eingebetteten Journalismus“ kann man auch die Zusammenarbeit vieler Afrikakorrespondenten mit ausländischen Hilfsorganisationen bezeichnen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung geht eben um einiges leichter auf, wenn Know-how, Transport und eventuell auch Unterkunft und Verpflegung durch (meist englischsprachiges) Rot- Kreuz-Personal oder Mitglieder von „Ärzte ohne Grenzen“ zur Verfügung gestellt werden. Als einfach zugängliche „Quellen“ stellen diese Menschen demnach einen Partner für viele Afrikakorrespondenten dar. Das enge Verhältnis zu den Organisationen kann jedoch, genau wie bei der Arbeit nah am Militär, zu bewussten oder unbewussten Einschränkungen der journalistischen Sicht führen. Unabhängiger Journalismus sieht eben doch anders aus.